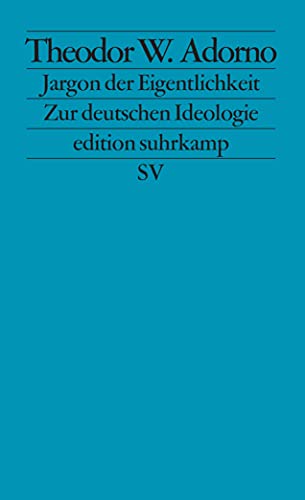Adornos Aufsatz ist mehr als eine Sprachkritik. Es ist ein Text zur Hermeneutik von Ursächlichkeiten und Zusammenhängen von Sprache, ihrem Gebrauch und ihrer Ideologie.
Das alles Sein eine Einheitlichkeit besitzt, struktuiert in sinnhaften Bezügen zwischen dem Seienden, was es von der amorphen Masse unterscheidet, ist ein Heideggersches Narrativ und Paradigma. Danach soll die Sprache die sinnhaften Bezüge der Eigentlichkeit des Seienden freilegen, den Sinn der Dinge benennen. ( Sein und Zeit)
Ein Euphemismus, sagt Adorno, vielmehr sei die Eigentlichkeit ein Zerfallsprodukt der Sprache, das sie in einen sinnentleerten Jargon verwandelt, der auch wie am Ende der Weimarer Republik, zum Jargon des Totalitarismus verkommen kann.
Die Eigentlichkeit der Dinge erscheine dabei als konzeptioneller Kontrapunkt zum " Uneigentlichen". Das aber als Negation benutzt, sei Sprachvernebelung.
Beispiel:
Der Gebrauch der Wendung " ...von je her", setzt ein Wissen voraus um die Entwicklung der Dinge, welches durch keinen Beweis gerechtfertigt sei. Wer wisse schon, ob etwas von " je her" so war und was sagt diese Bezeichnung also aus?
Ebenso ist die Bezeichnung, jemand sei "dafür auserwählt" bewusst irreführend.
Wer hätte ihn auserwählt, mit welcher Stimme und wann?
Das führt zur Manipulation durch Unschärfe, sagt Adorno, die bewusst ist.
Adornos Aufsatz ist nicht nur eine Kritik des Heideggerschen Ansatzes der Phänomenologie der " Selbigkeit", dass die Eigentlichkeit des Menschen die freie Findung seiner selbst bedeutet, im Gegensatz zu Fremdbestimmung und "Unfreiheit". ( Als Paradoxon)
Es ist eine Kritik des Ontologischen, das sagt, wie etwas sein soll, im Vergleich zu einem kritisch - analytischen Ansatz:
Zitat:
" Aber die von Heidegger gemeinte konkrete Eigentlichkeit ist nicht zu haben ohne das empirische, tatsächliche Subjekt, keine reine Möglichkeit des ontischen, sondern zugleich immer selbst ontisch." ( s.S.113 ff.)
Der Jargon der Eigentlichkeit ist für Adorno Ausdruck einer herrschenden Ideologie der " Scheinwürde", der sich nach dem Krieg erhalten habe in der Sprachlichkeit vor allem der offiziellen Würdenträger.
Verbunden für ihn immer zugleich mit dem Jargon des Nationalsozialismus. Daher auch die Wahl des Untertitels : " Zur deutschen Ideologie".
Vor allem" Edelsubstantive" eines nichtvorhandenen Geheimnisses " machten dabei eine Sprache aus des " fortschwelenden Unheils." Beispiel: "Sorge, Vertrauen, das" man" , das Gespür, Geborgenheit, etc.".
Es sei ein "ständiges Tremolo" hörbar, eine " Liturgie der Innerlichkeit", ohne die transzendenten Inhalte zu transportieren.
Fazit:
Die Kritik macht Sinn, wo man den " Worthülsen" nachspüren kann, die laut Adorno Sprache in Jargon verwandeln.
Allerdings lastet dem Aufsatz der Verdacht des Vorurteils an, der durch keine eigene erkennbare Bemühung entkräftet wird.
Seine Einlassung etwa, Heideggers "Gemäkel" an der Kulturphilosophie versuche diese " in die Hölle zu stossen" (s.S.85), lässt m.M.n. erkennen: Hier sitzt jemand doch allzusehr im Glashaus, um mit so grossen Steinen zu werfen.
Daher greift Adornos Kritik, so berechtigt diese im semantischen Bereich auch sein mag, erheblich zu kurz. Sie verliert sich in etwas kleinlicher Rechthaberei und schwächt dabei den eigenen durchaus gelungenen Entwurf. Es fehlt der Eindruck der Nüchternheit und Abgewogenheit seiner Einschätzung, der diese Arbeit zum Gelingen gebracht hätte.
So bleibt sie für mich ein Fragment, wenn auch ein Interessantes. Wegen diesem Mangel und wegen dem erkennbaren Desinteresse an einer einfachen und verständlichen Darstellung nur dreieinhalb Sterne. ![]()
![]()
![]()
![]()